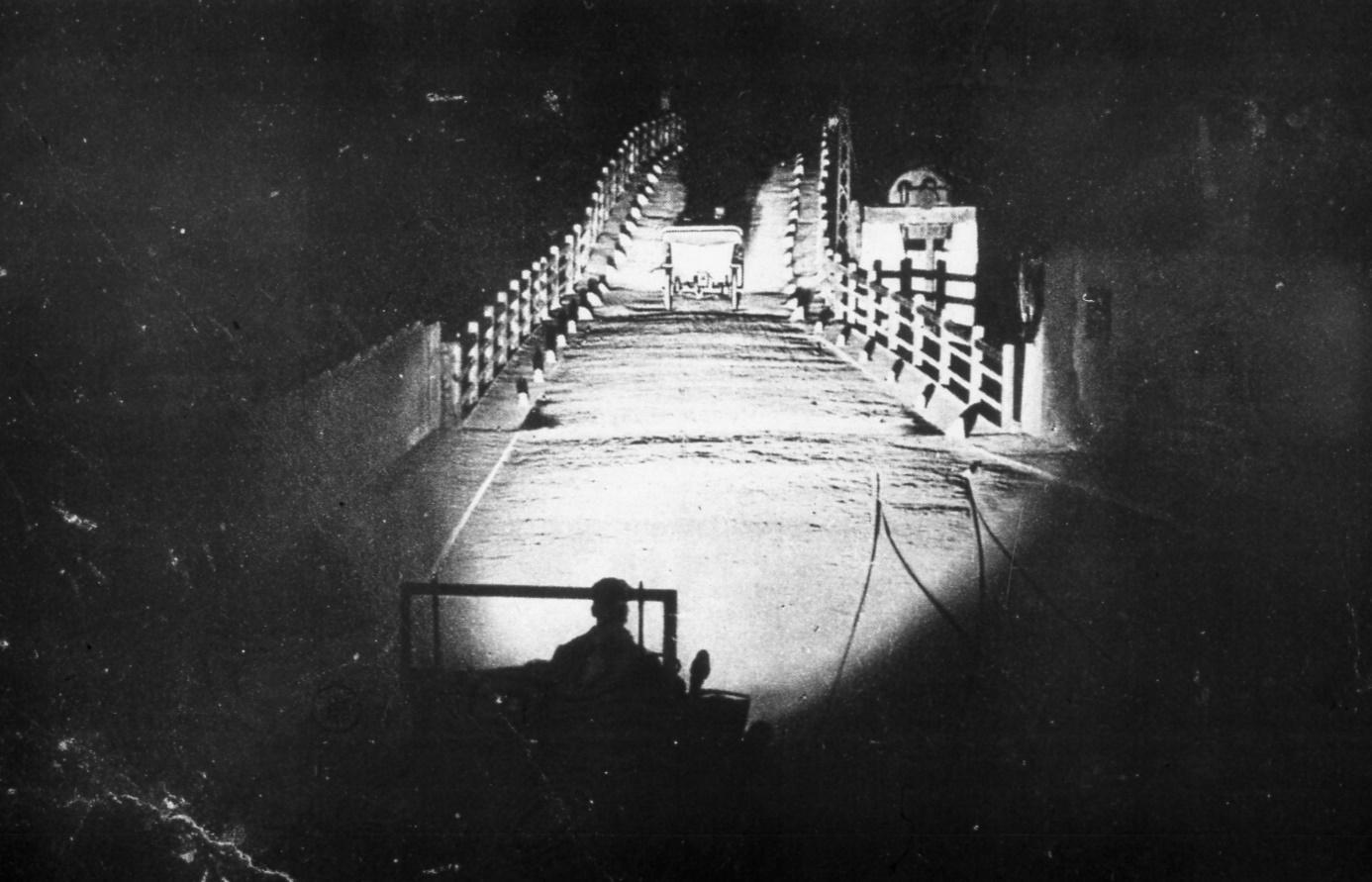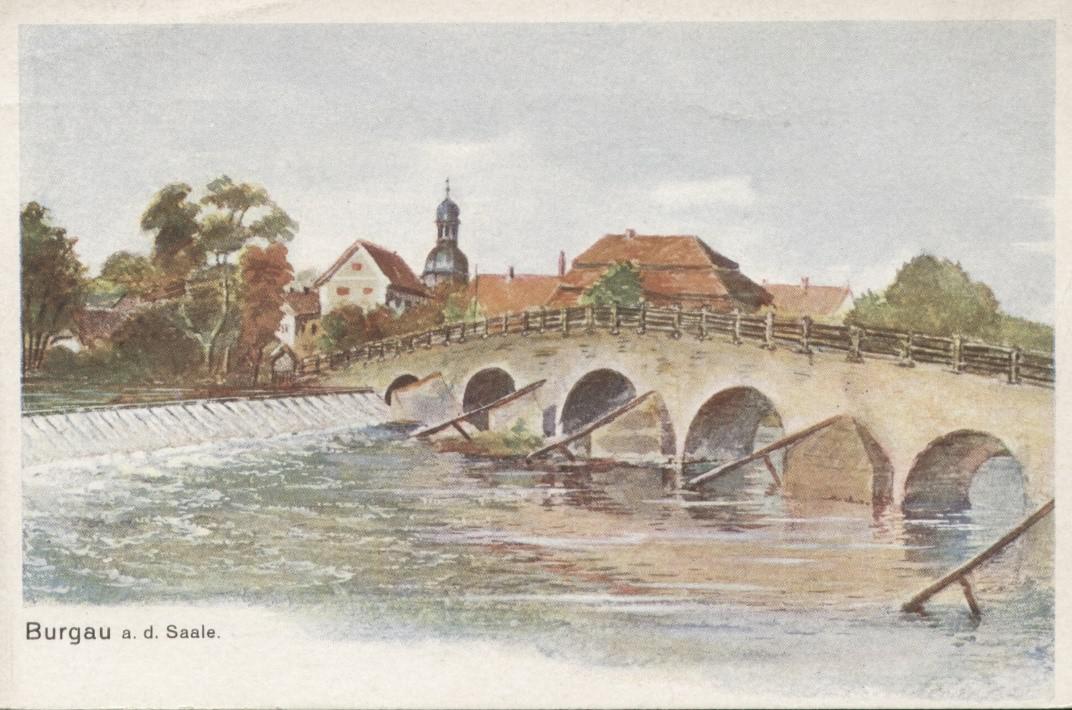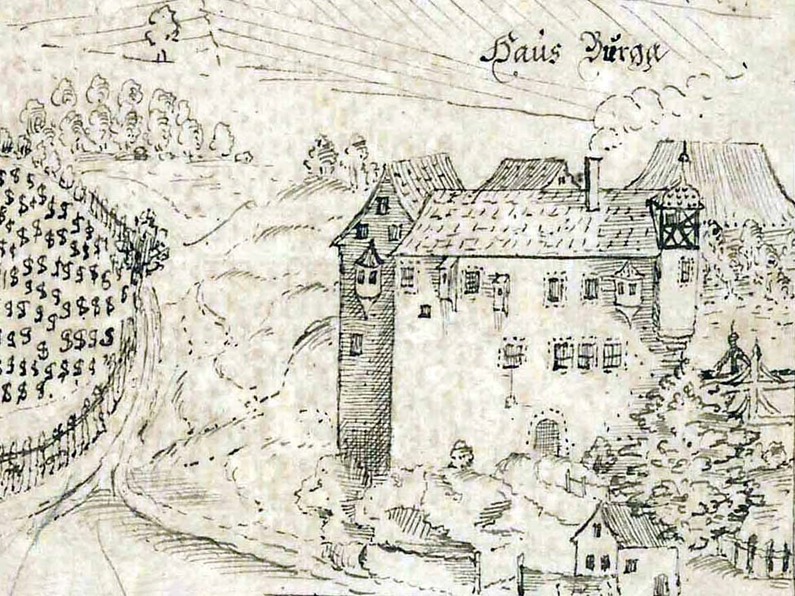Sie befinden Sie auf dem Historischen Ortsrundgang von Burgau.
Weitere Stationen finden Sie auf der unten stehenden Karte.
Hofanlage Geraer Straße 79 (Kulturdenkmal)
Das Burgauer Gut teilte sich im 19. Jahrhundert mit etwa 40 Bauern in die Burgauer Feldflur und beanspruchte dabei über achtzig Prozent der Bodenfläche. Die Bauernfamilien betrieben daneben noch eigene Handwerke mit kargen Erträgen und arbeiteten bei Bedarf auch auf dem Gut. So gelang es ihnen, sich zu ernähren und sich und ihre Höfe am Leben zu halten.
In Burgaus Dorfmitte befanden sich damals zwei stattliche Bauerngüter. Möglicherweise waren sie einmal aus einem Gut entstanden. Bauerngüter sind Bauernhöfe von einer Größe, die einer Bauernfamilie das Überleben aus eigner Arbeit ermöglicht und ihr auch erlaubt, sich zur Erleichterung ihrer Arbeit ein Arbeitspferd zu halten. Eines der beiden Bauerngüter ist der heutige Hof Geraer Straße 79.

Hofanlage Geraer Straße 79 (Foto H. Mey 1970er Jahre)
Das Bauernhaus richtet seinen Giebel zur Straße. Jedes Stockwerk lässt eigene Fenster ins Dorf blicken. Im Erdgeschoss spielte sich das alltägliche Leben der Bauernfamilie ab. Das mittlere Stockwerk diente der Ruhe und Entspannung, auch der Lebensfreude. Der Bauer könnte hier gesessen und ein Musikinstrument gespielt haben. Das oberste Geschoß diente dem Bewahren und Verwahren. Hier hinauf stieg man seltener. Eine feste Mauer trennt den Hof von der Dorfstraße. Eine hohe Durchfahrt für Erntefahrzeuge, die durch ein stabiles Tor verschließbar ist, und eine Personenpforte schaffen Durchlass durch die Mauer. Um den Hof herum ordnen sich Stallgebäude, Lagerstätten, Arbeitsräume und auch die Dungstätte, die täglich betreten werden muss. Sie hat die nächste reiche Ernte vorzubereiten. Beeindruckend sind die hohen, schweigsamen Scheunen, in denen der kleine Mensch emsig wirkt. Jahr für Jahr nehmen sie von Neuem anspruchsvolle Getreidegarben, Heu und auch Stroh auf, um alles bis zum Gebrauch zu bewahren. Auch Lebensmittel, empfindliche Früchte, Kartoffeln und Rüben lagerte der Bauer im Keller unterm Wohnhaus.
Auch auf diesem Hof haben die Eigentümer im Verlauf der Zeit gewechselt, doch sie bewohnten und bewirtschafteten ihren Hof immer selbst. Sie gaben ihm Leben. Erst als Julius Richard Berthold Herrmann (*25.11.1848), der vorbereitete Erbe des Hofes, zweiundzwanzigjährig als Gefreiter im Deutsch-Französischen Krieg 1870 – 1871 in der Schlacht von Loigny und Poupry am 02. Dezember 1870 bei Poupry in Frankreich fiel, brach eine lange Entwicklung zusammen. Der stattliche Bauernhof verfiel. Gewiss, der Vater, bereits Witwer, setzte seine Arbeit noch fort, doch ein geeigneter Erbe fand sich nicht mehr. Der Hof geriet in stiefmütterliche Betreuung. Ein halbes Jahrhundert versuchte sich die Familie mit ihm, dann fiel er 1946 der Bodenreform zu und wurde Neubauernhof. Bald darauf wurden nur die Felder und das Wohnhaus begehrt. Hof, Bergeräume und Stallungen schienen überflüssig. Das Gehöft ging an die Stadt Jena über, die es einem Reitsportverein zur Nutzung anbot. Er griff zu, doch zum Sanieren fehlte auch ihm das Geld. Erst nach der Wende ist es vom neuen Besitzer sehr aufwendig restauriert worden.
Wir vermissen zuverlässige Angaben zu diesem bedeutungsvollen Hof aus dem Mittelalter und aus der frühen Neuzeit. Ein Dorfbrand, von Frau Kruspons 1660 ausgelöst, hatte die historischen und die aktuellen Burgauer Gemeindeunterlagen vernichtet. Die Gemeinde hatte sie - um sie in unsicherer Zeit vor Raub und Vernichtung zu schützen - in der stabilen hölzernen Gemeindelade im Gemeindebrauhaus abgestellt. Doch ausgerechnet das Gemeindebrauhaus war in das Zentrum der Feuersbrunst geraten. So erreichen uns die ersten sporadischen Auskünfte zu unseren Vorfahren erst aus dem 18. Jahrhundert.
Nebenher. Der Brand hatte die Burgauer offenbar stark beeindruckt und geläutert. Seither hat Burgau nicht mehr unter Bränden zu leiden. Die Freunde der freiwilligen Feuerwehr trafen sich regelmäßig im ‚Spritzenhaus‘ auf dem Lindenberg und nach jeder Brandschutzübung ging man gemeinsam in den Gasthof „Linde“. Herr Pauland oder Manfred Bräunel spielten Zither und laut ließ die Mannschaft ihre Stimmen in den Himmel erschallen.
Das stattliche Gehöft mit kräftigem Gewölbekeller, wie es sich noch heute zeigt, geht auf das Jahr 1697 zurück. Bekannt ist, dass es von Hans Andreas Zaubitzer, fürstlicher Hof- und Schafmeister auf dem Gut Burgau, erworben wurde. Er starb 1698 und dicht drängten sich die Generationen der Kinder: Christoph, der Saalefischer, der in der Saale ertrank, Hans-Nicol, auch Saalefischer – hatte Goethe Hans-Nicols Fisch genossen? Dessen Tochter Eva, die Johann Ludwig Böhme heiratete, Maria Elisabeth Dorothea Böhme, die dann schließlich Johann Gottfried Herrmann in die Familie brachte. Nach Familie Herrmann, die folgend das Gehöft über mehrere Generationen bewirtschaftete wird es auch von vielen Burgauern noch benannt.
Ein Bauerngehöft war ein anspruchsvolles Grundstück zum Arbeiten und Leben. Nun ist es ein historisches Objekt. Die Häuser, Böden und Keller müssen ihre ursprünglichen Aufgaben nicht mehr erfüllen. Der Bewohner würdigt sie, indem er sie erhält und einer eigenen Nutzung zuführt. Ein anderthalbes Jahrhundert hatte das Gehöft unter unserer Neuzeit gelitten. Beträchtlich ist der Aufwand, um dem Gehöft seine Würde zurückzugeben und es in unserer Gegenwart zu nutzen. Es hatte unseren Vorfahren Lebensfreude verschafft und dankbar begegnen wir ihr auch in diesem Haus in den aufbereiteten Resten einer Bohlenstube, in dem gigantischen, aus regionalem Naturstein gefügtem Kellerrund und lassen uns von der monumentalen Stuckplastik in einer ruhigen Stube (Engelstube) zu den Seelen unserer Vorfahren führen. Der Künstler, der das Gesicht schuf, hatte hier im Haus zu Gast gewohnt, als er die Burgauer Kirche ausgestaltete. Die Bauernfamilie wünschte, für ewig mit ihm und seiner Kunst verbunden zu sein.

Toreinfahrt und separate Personenpforte mit schön gearbeitetem Holztor bzw. -tür (Foto H. Mey 1960er oder 1970er Jahre)
Weiterführende Literatur
Maetzig, D. (2011): Burgauer Familie. Die Familie Herrmann. – Burgauer Almanach. Beiträge zur Ortsgeschichte 2011: 75-78
Maetzig, D. (2015): Burgau und seine Höfe (2). – Burgauer Almanach. Beiträge zur Ortsgeschichte 2015: 35-101
Maetzig, D. (2018): Die Burgauer Familie Herrmann. – Burgauer Almanach. Beiträge zur Ortsgeschichte 2018: 97-112